Werden Armutsgefährdungsquoten auf Basis nationaler Schwellenwerte herangezogen, stechen insbesondere einige osteuropäische Länder mit sehr niedrigen Quoten hervor.
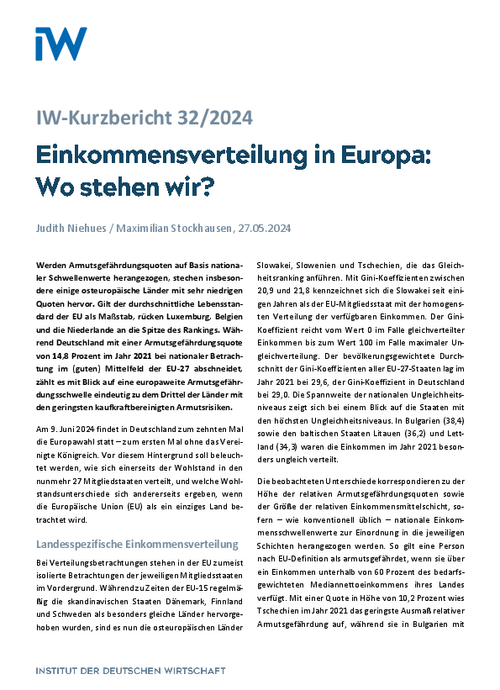
Einkommensverteilung in Europa: Wo stehen wir?

Werden Armutsgefährdungsquoten auf Basis nationaler Schwellenwerte herangezogen, stechen insbesondere einige osteuropäische Länder mit sehr niedrigen Quoten hervor.
Gilt der durchschnittliche Lebensstandard der EU als Maßstab, rücken Luxemburg, Belgien und die Niederlande an die Spitze des Rankings. Während Deutschland mit einer Armutsgefährdungsquote von 14,8 Prozent im Jahr 2021 bei nationaler Betrachtung im (guten) Mittelfeld der EU-27 abschneidet, zählt es mit Blick auf eine europaweite Armutsgefährdungsschwelle eindeutig zu dem Drittel der Länder mit den geringsten kaufkraftbereinigten Armutsrisiken.
Am 9. Juni 2024 findet in Deutschland zum zehnten Mal die Europawahl statt – zum ersten Mal ohne das Vereinigte Königreich. Vor diesem Hintergrund soll beleuchtet werden, wie sich einerseits der Wohlstand in den nunmehr 27 Mitgliedstaaten verteilt, und welche Wohlstandsunterschiede sich andererseits ergeben, wenn die Europäische Union (EU) als ein einziges Land betrachtet wird.
<iframe src="https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/HTML/2024/einkommen_europa/index.html" frameborder="0" height="900px" width="100%" scrolling="no"></iframe>
Landesspezifische Einkommensverteilung
Bei Verteilungsbetrachtungen stehen in der EU zumeist isolierte Betrachtungen der jeweiligen Mitgliedsstaaten im Vordergrund. Während zu Zeiten der EU-15 regelmäßig die skandinavischen Staaten Dänemark, Finnland und Schweden als besonders gleiche Länder hervorgehoben wurden, sind es nun die osteuropäischen Länder Slowakei, Slowenien und Tschechien, die das Gleichheitsranking anführen. Mit Gini-Koeffizienten zwischen 20,9 und 21,8 kennzeichnet sich die Slowakei seit einigen Jahren als der EU-Mitgliedsstaat mit der homogensten Verteilung der verfügbaren Einkommen. Der Gini-Koeffizient reicht vom Wert 0 im Falle gleichverteilter Einkommen bis zum Wert 100 im Falle maximaler Ungleichverteilung. Der bevölkerungsgewichtete Durchschnitt der Gini-Koeffizienten aller EU-27-Staaten lag im Jahr 2021 bei 29,6, der Gini-Koeffizient in Deutschland bei 29,0. Die Spannweite der nationalen Ungleichheitsniveaus zeigt sich bei einem Blick auf die Staaten mit den höchsten Ungleichheitsniveaus. In Bulgarien (38,4) sowie den baltischen Staaten Litauen (36,2) und Lettland (34,3) waren die Einkommen im Jahr 2021 besonders ungleich verteilt.
<iframe class="everviz-iframe" src="https://app.everviz.com/embed/ZLDKe-dcT/?v=14" title="Chart: Arm und reich nach nationalen Maßstäben" style="border: 0; width: 100%; height: 500px"></iframe>
Die beobachteten Unterschiede korrespondieren zu der Höhe der relativen Armutsgefährdungsquoten sowie der Größe der relativen Einkommensmittelschicht, sofern – wie konventionell üblich – nationale Einkommensschwellenwerte zur Einordnung in die jeweiligen Schichten herangezogen werden. So gilt eine Person nach EU-Definition als armutsgefährdet, wenn sie über ein Einkommen unterhalb von 60 Prozent des bedarfsgewichteten Mediannettoeinkommens ihres Landes verfügt. Mit einer Quote in Höhe von 10,2 Prozent wies Tschechien im Jahr 2021 das geringste Ausmaß relativer Armutsgefährdung auf, während sie in Bulgarien mit 22,9 Prozent am höchsten ausfiel. Im bevölkerungsgewichteten Durchschnitt der EU-27 lag die Armutsgefährdungsquote bei 16,5 Prozent.
Korrespondierend zur geringen Ungleichheit wies die Slowakei mit einem Anteil von beinahe zwei Drittel (62,3 Prozent) den höchsten Bevölkerungsanteil in der landesspezifischen Mittelschicht auf, die nach IW-Definition einen Einkommensbereich von 80 bis 150 Prozent des nationalen Medianeinkommens aufspannt. Am anderen Ende des Spektrums zählte in Bulgarien nur etwas mehr als jeder Dritte zur Mittelschicht in diesem engen Sinn (35,2 Prozent).
Gemessen am nationalen Medianeinkommen liegt Deutschlands Armutsgefährdungsquote auf Basis der europäischen Daten mit 14,8 Prozent unter dem Durchschnitt der EU-27. Mit der Größe der landesspezifischen Mittelschicht rangiert Deutschland im Mittelfeld: Im Jahr 2021 zählten 48 Prozent der deutschen Bevölkerung zur Einkommensmittelschicht im engen Sinn (i. e. S.). Dieses Ergebnis passt zu vergleichbaren Betrachtungen, wonach auch in früheren Jahren ungefähr jeder Zweite in Deutschland zur analog abgegrenzten Einkommensmittelschicht zählte (Niehues, 2018; Niehues/Stockhausen, 2022).
Die EU als supranationale Einheit
Da sich die konventionelle Armutsgefährdungsmessung sowie die Schichtzugehörigkeit am mittleren Lebensstandard des jeweiligen Landes orientieren, bleiben bei der Beurteilung des Armutsrisikos oder der Größe der landesspezifischen Einkommensmittelschicht Unterschiede in den Lebensverhältnissen zwischen den EU-Staaten außen vor. Eine andere Perspektive ergibt sich, wenn die EU als ein einziges Land beziehungsweise als supranationale Einheit betrachtet und der Frage nachgegangen wird, wie sich die Menschen in die europaweite Einkommensverteilung einsortieren.
Zur Berechnung einer europaweiten Einkommensverteilung müssen zunächst die Preisniveauunterschiede zwischen den Ländern berücksichtigt werden. Denn mit einem bestimmten Eurobetrag lassen sich in Deutschland weniger Waren und Dienstleistungen kaufen als im Durchschnitt der übrigen EU-Staaten. Daher werden die nationalen Währungen mit Hilfe von Kaufkraftparitäten in sogenannte Kaufkraftstandards (KKS) umgerechnet. Mit einem KKS können sich die Konsumenten in allen Ländern theoretisch die gleiche Menge an Waren und Dienstleistungen kaufen – ein KKS entspricht somit der durchschnittlichen Kaufkraft eines Euros in der EU-27. In Deutschland betrug die Kaufkraftparität – berechnet auf Basis der Konsumausgaben der privaten Haushalte – gegenüber den übrigen EU-Staaten im Jahr 2021 rund 1,08. Die Summe von 1.000 Euro in deutschen Preisen hat somit eine durchschnittliche Kaufkraft von 926 KKS.
Fasst man alle individuellen Einkommen der EU-27 kaufkraftbereinigt zusammen, dann liegt das bedarfsgewichtete Medianeinkommen im Jahr 2021 bei 1.529 KKS (rund 1.651 Euro in deutschen Preisen). Knapp ein Fünftel der Menschen in der EU verfügen über weniger als 60 Prozent des kaufkraftbereinigten EU-weiten Medianeinkommens und zählen demnach als kaufkraftbereinigt armutsgefährdet (Abbildung). In Luxemburg, dem Land mit dem höchsten kaufkraftbereinigtem Medianeinkommen, ist die Verschiebung zwischen nationaler und supranationaler Betrachtung besonders deutlich: Gegenüber 18,5 Prozent nach nationaler Referenz zählen gemäß des europäischen Schwellenwerts über 60 Prozent der luxemburgischen Bevölkerung zur oberen Mittelschicht oder zu den relativ Einkommensreichen Europas.
<iframe class="everviz-iframe" src="https://app.everviz.com/embed/LxQrDj37m/?v=20" title="Chart: " style="border: 0; width: 100%; height: 500px"></iframe>
Auch wenn sich in allen EU-Ländern, aber insbesondere in den osteuropäischen Mitgliedsstaaten seit 2010 substanzielle Zuwächse beim real verfügbaren Einkommen gezeigt haben (Eurostat, 2024, Figure 2), liegen in einigen Ländern die kaufkraftbereinigten Medianeinkommen weiterhin unterhalb der kaufkraftbereinigten europäischen Armutsrisikoschwelle in Höhe von 918 KKS (rund 991 Euro in deutschen Preisen) – so zählt mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Ungarn, Bulgarien oder Rumänien bei supranationaler Betrachtung zu den kaufkraftbereinigt Armutsgefährdeten. Während Ungarn und die Slowakei beim Blick auf die nationalen Armutsgefährdungsquoten als Länder mit unterdurchschnittlichen Armutsrisiken eingeordnet werden, sortieren sie sich beim europäischen Kaufkraftvergleich zu den Ländern mit den höchsten Armutsrisiken.
In Deutschland liegt das kaufkraftbereinigte Medianeinkommen mit 1.942 KKS (2.097 Euro in deutschen Preisen) deutlich oberhalb des EU-weiten Werts. Gemessen am EU-weiten Schwellenwert halbiert sich die Zahl der armutsgefährdeten Menschen in Deutschland entsprechend auf 7,1 Prozent. Die meisten Menschen Deutschlands, die nach nationalem Referenzwert zur „unteren“ Mitte zählen, würden gemäß EU-weitem Medianeinkommen in die europäische Mittelschicht i. e. S. aufsteigen. Gleichermaßen steigen viele Deutsche von der Mitte i. e. S. in die obere Mitte auf, wenn sich die Perspektive verändert, sodass die Mitte i. e. S. in beiden Fällen numerisch sehr ähnlich besetzt ist (national 48,1 Prozent versus EU-weit 46,3 Prozent). 28,3 Prozent der deutschen Bevölkerung erreichen mit ihrem kaufkraftbereinigten Einkommen die Gruppe der oberen Mitte (16,2 Prozent gemäß nationaler Referenz) und 8,4 Prozent die Gruppe der relativ Reichen (3,7 Prozent gemäß nationaler Referenz). Der Anteil der relativ Einkommensreichen ist bei EU-weiter Perspektive nur in Österreich mit 8,7 Prozent und in Luxemburg mit 25,0 Prozent höher. Die Verschiebungen in höhere Einkommensschichten unterstreichen das auch kaufkraftbereinigt im EU-Vergleich überdurchschnittliche Wohlstandsniveau in Deutschland.
Daten und Methodik
Datengrundlage ist die europäische Erhebung über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) aus dem Jahr 2022. Es werden Haushaltseinkommen nach Steuern, Abgaben und Transferleistungen (Nettoeinkommen) betrachtet, die sich auf das Vorjahr 2021 beziehen. Alle Einkommen werden gemäß der neuen OECD-Skala in Nettoäquivalenzeinkommen umgerechnet. Die Einkommensschichten werden in Relation zum Median der nominalen Nettoäquivalenzeinkommen gebildet (Niehues/Stockhausen, 2022): "Relativ Arme": unter 60 Prozent, "Untere Mitte": 60 bis 80 Prozent, "Mitte im engen Sinn": 80 bis 150 Prozent, "Obere Mitte": 150 bis 250 Prozent, "Relativ Reiche": mehr als 250 Prozent.
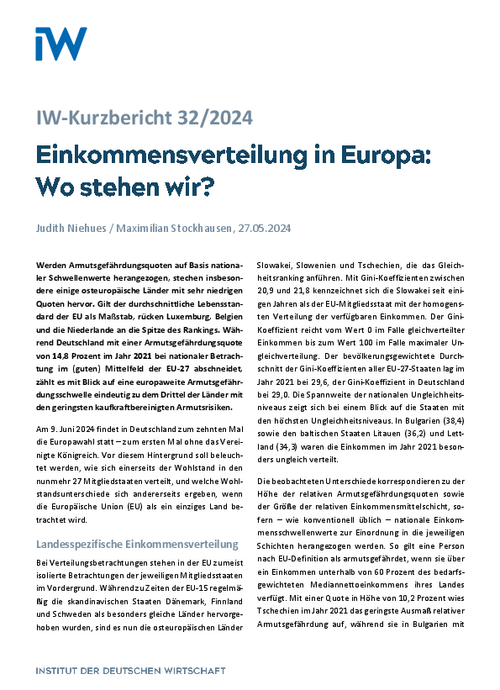
Einkommensverteilung in Europa: Wo stehen wir?


IW-Verteilungsreport 2023: Einstellungen zur sozialen Mobilität
Fundamental verknüpft mit der sozialen Marktwirtschaft ist die Vorstellung, dass jeder Mensch unabhängig von seiner Herkunft die Möglichkeit zum sozialen Aufstieg hat und dass es den eigenen Kindern in Zukunft bessergehen soll als den Eltern heute.
IW
Neuer Kaufkraft-Index: Wo die Menschen sich am meisten leisten können
Wenn Einkommen hoch und Preise niedrig sind, freuen sich die Konsumenten. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat erstmals für ganz Deutschland untersucht, wo sich die Menschen am meisten von ihrem Geld leisten können.
IW