Die bis Ende des laufenden Jahres befristete steuer- und sozialabgabenfreie Einmalzahlung sollte und soll als Teil der Entlastungspakete die Folgen der Energiepreiskrise abfedern. Damit verzichtet der Staat auf Einnahmen von schätzungsweise 25 Milliarden Euro zugunsten der Privathaushalte.
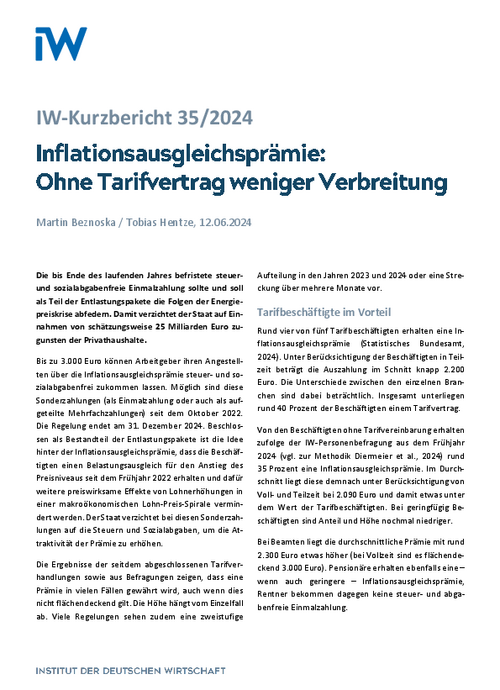
Inflationsausgleichsprämie: Ohne Tarifvertrag weniger Verbreitung

Die bis Ende des laufenden Jahres befristete steuer- und sozialabgabenfreie Einmalzahlung sollte und soll als Teil der Entlastungspakete die Folgen der Energiepreiskrise abfedern. Damit verzichtet der Staat auf Einnahmen von schätzungsweise 25 Milliarden Euro zugunsten der Privathaushalte.
Bis zu 3.000 Euro können Arbeitgeber ihren Angestellten über die Inflationsausgleichsprämie steuer- und sozialabgabenfrei zukommen lassen. Möglich sind diese Sonderzahlungen (als Einmalzahlung oder auch als aufgeteilte Mehrfachzahlungen) seit dem Oktober 2022. Die Regelung endet am 31. Dezember 2024. Beschlossen als Bestandteil der Entlastungspakete ist die Idee hinter der Inflationsausgleichsprämie, dass die Beschäftigten einen Belastungsausgleich für den Anstieg des Preisniveaus seit dem Frühjahr 2022 erhalten und dafür weitere preiswirksame Effekte von Lohnerhöhungen in einer makroökonomischen Lohn-Preis-Spirale vermindert werden. Der Staat verzichtet bei diesen Sonderzahlungen auf die Steuern und Sozialabgaben, um die Attraktivität der Prämie zu erhöhen.
Die Ergebnisse der seitdem abgeschlossenen Tarifverhandlungen sowie aus Befragungen zeigen, dass eine Prämie in vielen Fällen gewährt wird, auch wenn dies nicht flächendeckend gilt. Die Höhe hängt vom Einzelfall ab. Viele Regelungen sehen zudem eine zweistufige Aufteilung in den Jahren 2023 und 2024 oder eine Streckung über mehrere Monate vor.
Tarifbeschäftigte im Vorteil
Rund vier von fünf Tarifbeschäftigten erhalten eine Inflationsausgleichsprämie (Statistisches Bundesamt, 2024). Unter Berücksichtigung der Beschäftigten in Teilzeit beträgt die Auszahlung im Schnitt knapp 2.200 Euro. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen sind dabei beträchtlich. Insgesamt unterliegen rund 40 Prozent der Beschäftigten einem Tarifvertrag.
Von den Beschäftigten ohne Tarifvereinbarung erhalten zufolge der IW-Personenbefragung aus dem Frühjahr 2024 (vgl. zur Methodik Diermeier et al., 2024) rund 35 Prozent eine Inflationsausgleichsprämie. Im Durchschnitt liegt diese demnach unter Berücksichtigung von Voll- und Teilzeit bei 2.090 Euro und damit etwas unter dem Wert der Tarifbeschäftigten. Bei geringfügig Beschäftigten sind Anteil und Höhe nochmal niedriger.
Bei Beamten liegt die durchschnittliche Prämie mit rund 2.300 Euro etwas höher (bei Vollzeit sind es flächendeckend 3.000 Euro). Pensionäre erhalten ebenfalls eine – wenn auch geringere – Inflationsausgleichsprämie, Rentner bekommen dagegen keine steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung.
Eine Abschätzung des fiskalischen Effekts ist mit Unsicherheiten behaftet, da Unternehmen die Prämie noch bis zum 31. Dezember 2024 leisten oder bis zum Maximalwert erhöhen können. Aus diesem Grund bilden die Befragungsergebnisse der Beschäftigten auch eher eine Untergrenze, da teilweise auch Unwissenheit über den Erhalt besteht. Ausgehend von den bisherigen Daten lässt sich die fiskalische Wirkung jedoch bereits grob berechnen. Die Annahme hierbei ist, dass die Ausschüttung der Prämie als Lohnbestandteil ohne die Steuer- und Abgabenfreistellung im selben Ausmaß und Zeitraum als reguläre Lohnerhöhung erfolgt wäre. Nach den Ergebnissen erhalten knapp 20 Millionen Beschäftigte eine Prämie, gleichbedeutend mit rund 53 Prozent der Grundgesamtheit. Im Schnitt betrug die ausgezahlte Prämie rund 2.150 Euro.
Starker, aber unsichtbarer Fiskaleffekt
Nimmt man in einer vereinfachten Steuersimulation nach Lohngruppen in der IW-Erhebung den durchschnittlichen Bruttolohn, die Verbreitung und die durchschnittliche Prämienhöhe und ermittelt die Grenzsteuersätze sowie die Sozialabgabensätze (bei Kinderlosen 41,5 Prozent), so lassen sich die Einnahmeausfälle des Staates abschätzen. Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass dies nur approximativ möglich ist, denn zum Beispiel sind nicht alle Beschäftigten gesetzlich versichert, und es müssen weitere Annahmen zur Bestimmung der Grenzsteuersätze getroffen werden. Berücksichtigt wird hingegen, dass die Sozialabgaben wiederum die steuerliche Bemessungsgrundlage und damit die Steuereinnahmen mindern.
Vor diesem Hintergrund ist mit einem staatlichen Zuschuss in Form von nicht erhobenen Steuern und Sozialabgaben in Höhe von rund 25 Milliarden Euro im Zeitraum von Oktober 2022 bis Ende 2024 zu rechnen, wovon 13 Milliarden Euro auf die Sozialbeiträge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber sowie 12 Milliarden Euro auf die Lohnsteuer entfallen.
Damit spielt die Inflationsausgleichsprämie aus fiskalischer Sicht bei den Entlastungsmaßnahmen eine maßgebliche Rolle (Beznoska et al., 2023). Allerdings wird der Effekt nicht unmittelbar sichtbar, da es zu keinen Zahlungen des Staates kommt und auch die Einnahmeausfälle ex-ante nicht geschätzt wurden. Daher wird der Fiskaleffekt auch nicht statistisch dokumentiert.
Zu berücksichtigen ist, dass es sich bei dem Wert von 25 Milliarden Euro um eine statische Abschätzung handelt. Zu erwarten ist, dass die höheren verfügbaren Einkommen zu einem Großteil für Konsum eingesetzt werden, so dass dies bei einer dynamischen Betrachtung wiederum in zusätzlichen Steuereinnahmen resultiert, wodurch der Gesamteffekt geringer ausfällt.
Aus dem berechneten Wert der entgangenen Steuern und Sozialabgaben lässt sich zudem nicht schlussfolgern, dass ohne diese Vergünstigung Steuern und Sozialabgaben in der genannten Höhe geflossen wären. Denn der Fiskalanreiz führt vermutlich zu Verhaltensanpassungen, das heißt nicht alle Beschäftigten hätten ohne die Vergünstigung eine Bruttolohnerhöhung in der Zeit in gleichem Umfang erhalten.
<iframe class="everviz-iframe" src="https://app.everviz.com/embed/U7Vj6plCS/?v=11" title="Chart: Inflationsausgleichsprämie" style="border: 0; width: 100%; height: 500px"></iframe>
Verteilungspolitisch zielführende Prämie
Verteilungspolitisch führt die Regelung dazu, dass bezogen auf den Jahresbruttolohn vor allem Gering- und Normalverdiener profitieren, da es in der Regel pauschale Einmalzahlungen ohne Berücksichtigung der Höhe des Bruttolohns gibt (Abbildung). Die relative Bedeutung der gezahlten Prämie sinkt von über 13 Prozent in der untersten Lohngruppe bis auf 2 Prozent in der obersten. Allerdings steigt der Anteil der Beschäftigten, die eine Prämie bekommen, mit der Lohnhöhe. Von 25 Prozent in der untersten Gruppe erhöht sich der Anteil bis in den Lohnbereich von 4.000 Euro bis 5.000 Euro auf über 60 Prozent und sinkt dann wieder leicht.
Steuer- und sozialabgabenfreie Einmalzahlungen wären in normalen Zeiten eine unangemessene Subvention. Doch vor dem Hintergrund der hohen Inflation war es ein Ziel der Politik, eine Lohn-Preis-Spirale zu verhindern. Bei hohen Lohnabschlüssen – denen keine entsprechenden Produktivitätssteigerungen gegenüberstehen – ist davon auszugehen, dass ein großer Teil der Unternehmen die gestiegenen Personalkosten an die Verbraucher zumindest in weiten Teilen weitergeben muss, zumal sich auch andere Produktionskosten zuletzt stark verteuert haben. In der Folge würden die Preise für Güter und Dienstleistungen vielerorts weiter steigen.
Einmalzahlungen helfen unmittelbar dabei, höhere Konsumausgaben zu tätigen, vermindern aber das Risiko einer Lohn-Preis-Spirale, weil die Kosten der Unternehmen nicht dauerhaft steigen. Zwar läuft der Kaufkrafteffekt wieder aus, während die Wirkung der Inflation bleibt. Diese lassen sich aber nach Überwindung des exogenen Preisschocks schrittweise wieder im Zuge künftiger Tarifverhandlungen ausgleichen. Es liegt zudem nahe, dass die Konfliktintensität in den Tarifverhandlungen im vergangenen Jahr ohne Inflationsausgleichsprämie deutlich stärker gewesen wäre (Lesch/Eckle, 2024). Nach Auslaufen des Instruments zum Jahresende stellt sich gleichwohl die Frage, inwieweit zukünftige Lohnverhandlungen die Stabilität weiterhin sicherstellen (Obst/Stockhausen, 2024).
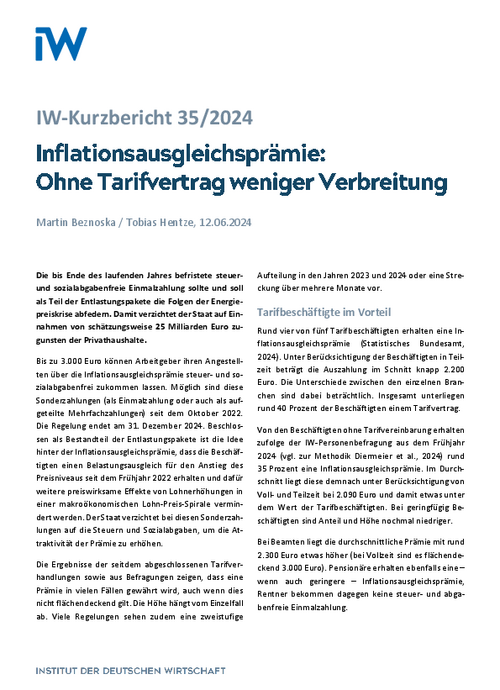
Inflationsausgleichsprämie: Ohne Tarifvertrag weniger Verbreitung


Bundeshaushalt: Zinslasten und realer Einnahmenrückgang setzen Regierung unter Druck
Das Haushaltsvolumen des Jahres 2024 ist gegenüber dem Jahr 2019, dem letzten Vorkrisenjahr, um ein Drittel oder 120 Milliarden Euro gestiegen. Zinsen und Soziales sind dafür maßgeblich verantwortlich. Die Steuereinnahmen können im Vergleich dazu nicht ...
IW
Schuldenbremse 2.0: Konzepte für tragfähige Fiskalregeln
In der aktuellen Debatte um die deutsche Schuldenbremse mehren sich die Stimmen, die eine Reform der Fiskalregeln empfehlen. Neben dem Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz spricht sich auch der Sachverständigenrat für ...
IW