Die Europäische Union verpflichtet mit verschiedenen neuen Vorschriften immer mehr Unternehmen dazu, ihre Aktivitäten in Sachen Nachhaltigkeit offenzulegen. Manche Unternehmen erstellen auch bereits auf freiwilliger Basis Nachhaltigkeitsberichte.
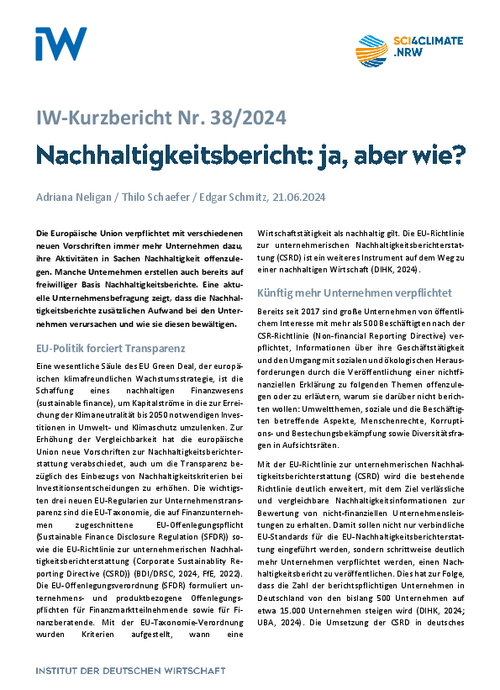
Nachhaltigkeitsbericht: ja, aber wie?

Die Europäische Union verpflichtet mit verschiedenen neuen Vorschriften immer mehr Unternehmen dazu, ihre Aktivitäten in Sachen Nachhaltigkeit offenzulegen. Manche Unternehmen erstellen auch bereits auf freiwilliger Basis Nachhaltigkeitsberichte.
Eine aktuelle Unternehmensbefragung zeigt, dass die Nachhaltigkeitsberichte zusätzlichen Aufwand bei den Unternehmen verursachen und wie sie diesen bewältigen.
EU-Politik forciert Transparenz
Eine wesentliche Säule des EU Green Deal, der europäischen klimafreundlichen Wachstumsstrategie, ist die Schaffung eines nachhaltigen Finanzwesens (sustainable finance), um Kapitalströme in die zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2050 notwendigen Investitionen in Umwelt- und Klimaschutz umzulenken. Zur Erhöhung der Vergleichbarkeit hat die europäische Union neue Vorschriften zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verabschiedet, auch um die Transparenz bezüglich des Einbezugs von Nachhaltigkeitskriterien bei Investitionsentscheidungen zu erhöhen. Die wichtigsten drei neuen EU-Regularien zur Unternehmenstransparenz sind die EU-Taxonomie, die auf Finanzunternehmen zugeschnittene EU-Offenlegungspflicht (Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)) sowie die EU-Richtlinie zur unternehmerischen Nachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainablity Reporting Directive (CSRD)) (BDI/DRSC, 2024, FfE, 2022). Die EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) formuliert unternehmens- und produktbezogene Offenlegungspflichten für Finanzmarktteilnehmende sowie für Finanzberatende. Mit der EU-Taxonomie-Verordnung wurden Kriterien aufgestellt, wann eine Wirtschaftstätigkeit als nachhaltig gilt. Die EU-Richtlinie zur unternehmerischen Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) ist ein weiteres Instrument auf dem Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaft (DIHK, 2024).
Künftig mehr Unternehmen verpflichtet
Bereits seit 2017 sind große Unternehmen von öffentlichem Interesse mit mehr als 500 Beschäftigten nach der CSR-Richtlinie (Non-financial Reporting Directive) verpflichtet, Informationen über ihre Geschäftstätigkeit und den Umgang mit sozialen und ökologischen Herausforderungen durch die Veröffentlichung einer nichtfinanziellen Erklärung zu folgenden Themen offenzulegen oder zu erläutern, warum sie darüber nicht berichten wollen: Umweltthemen, soziale und die Beschäftigten betreffende Aspekte, Menschenrechte, Korruptions- und Bestechungsbekämpfung sowie Diversitätsfragen in Aufsichtsräten.
<iframe class="everviz-iframe" src="https://app.everviz.com/embed/rCD7hiTcy/?v=6" title="Chart: Unternehmerische Maßnahmen für eine Nachhaltigkeitsberichterstattung" style="border: 0; width: 100%; height: 500px"></iframe>
Mit der EU-Richtlinie zur unternehmerischen Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) wird die bestehende Richtlinie deutlich erweitert, mit dem Ziel verlässliche und vergleichbare Nachhaltigkeitsinformationen zur Bewertung von nicht-finanziellen Unternehmensleistungen zu erhalten. Damit sollen nicht nur verbindliche EU-Standards für die EU-Nachhaltigkeitsberichterstattung eingeführt werden, sondern schrittweise deutlich mehr Unternehmen verpflichtet werden, einen Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen. Dies hat zur Folge, dass die Zahl der berichtspflichtigen Unternehmen in Deutschland von den bislang 500 Unternehmen auf etwa 15.000 Unternehmen steigen wird (DIHK, 2024; UBA, 2024). Die Umsetzung der CSRD in deutsches Recht soll bis zum 6. Juli 2024 erfolgen. Im März 2024 wurde hierfür ein Referentenentwurf aus dem Bundesministerium der Justiz vorgestellt, der im Wesentlichen die EU-Richtlinie umsetzt. Vorgesehen ist auch, dass künftig der Sorgfaltspflichtenbericht im Rahmen des deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes entfallen kann, wenn ein nach den CSRD-Regeln erstellter Nachhaltigkeitsbericht erstellt und veröffentlicht wird.
Große Unternehmen: Berichte nicht neu
Im Frühjahr 2024 wurden knapp 900 Unternehmen aus den Industrie- sowie den unternehmensnahen Dienstleistungsbranchen mit mindestens einem sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Rahmen des IW-Zukunftspanels für das Projekt SCI4climate.NRW befragt, ob, für wen und wie sie Nachhaltigkeitsberichte erstellen.
Zahlreiche Unternehmen erstellen Nachhaltigkeitsberichte bereits auf freiwilliger Basis oder planen dies. Dabei zeigt sich, dass der Anteil, der Unternehmen, die freiwillig oder künftig einen Bericht anfertigen, mit der Unternehmensgröße deutlich ansteigt. Während drei von zehn kleinen Unternehmen (1 bis 49 Mitarbeitende) freiwillig einen Bericht erstellen oder dies planen, sind es neun von zehn großen Unternehmen (ab 250 Mitarbeitende), die gesetzlich verpflichtet oder freiwillig einen Bericht erstellen oder dies planen. Das überrascht nicht, da viele dieser Unternehmen sukzessive berichtspflichtig werden und dies schon vorbereiten.
Unternehmerische Nachhaltigkeitsberichterstattung hat das Ziel, verschiedene Stakeholder über Nachhaltigkeitsaspekte zu informieren. Laut der Umfrage sind das insbesondere direkte Geschäftspartner, beispielsweise aufgrund von Anforderungen seitens der Kunden und Auftraggeber (72 Prozent), aber auch die Belegschaft und die Öffentlichkeit (51 Prozent) sowie externe Kapitalgeber für bessere Finanzierungsbedingungen bei Banken und am Kapitalmarkt (23 Prozent). Bei Unternehmen, die exportieren, haben direkte Geschäftspartner als Zielgruppe eine noch höhere Bedeutung mit 77 Prozent. Während von den kleinen Unternehmen (bis 49 Mitarbeitende), die einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen, nur jedes zweite einen Bericht für die Belegschaft und Öffentlichkeit anfertigt, sind es mehr als drei Viertel der größeren Unternehmen.
Kleine Firmen ohne spezialisierte Kräfte
Befragt nach den Maßnahmen, die Unternehmen zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsberichterstattung ergriffen haben bzw. planen, zeigt sich, dass in jedem zweiten Unternehmen, insbesondere bei den kleinen Unternehmen (bis 49 Mitarbeitende), die nachhaltigkeitsbezogenen Aufgaben Mitarbeitende schon übernehmen oder künftig übernehmen sollen, ohne dafür speziell weitergebildet worden zu sein.
45 Prozent derjenigen Unternehmen, die bereits einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen, geben aber auch an, ihre Mitarbeitende speziell weitergebildet zu haben. Bei denjenigen Unternehmen, die bisher die Berichterstattung noch planen, sind es knapp zwei Fünftel der Unternehmen. Vor allem große Unternehmen (ab 250 Mitarbeitende) setzen hier auf spezielle Weiterbildung – hier sind es 58 Prozent, die die Berichterstattung so bereits umsetzen oder dies planen (Abbildung).
Ein Fünftel der Unternehmen, die schon Erfahrung mit Nachhaltigkeitsberichten haben, beauftragen dafür externe Dienstleister wie Beratungsfirmen oder Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Bei den Unternehmen, die die Berichterstattung bisher lediglich planen, ist es eines von vier Unternehmen, die auf externe Dienstleister zurückgreifen wollen. Während kleine Unternehmen dies deutlich seltener bereits machen oder planen (20 Prozent), nutzen vor allem mittelgroße Unternehmen (50 bis 249 Mitarbeitende) mit 40 Prozent und auch große Unternehmen (ab 250 Mitarbeitende) mit knapp einem Drittel deutlich häufiger eine solche Lösung außerhalb des Unternehmens.
Nur wenige Unternehmen haben neues qualifiziertes Personal hierfür eingestellt (8 Prozent) oder planen dies (3 Prozent). Dieser Anteil der Unternehmen, die dies bereits machen oder planen, steigt deutlich mit der Unternehmensgröße: von 4 Prozent (bis 49 Mitarbeitende), über 15 Prozent (50 bis 250 Mitarbeitende) auf 26 Prozent (ab 250 Mitarbeitende).
Fazit
Die Standardisierung der Berichtspflichten kann die Transparenz, Qualität und Vergleichbarkeit von Unternehmensaktivitäten für Investoren und andere Interessengruppen, einschließlich Nichtregierungsorganisationen verbessern. Mithilfe der Berichterstattungsstandards können sowohl die Kreditrisiken als auch die Umweltfreundlichkeit der vorgestellten Projekte von den Anlegern besser bewertet und mit ähnlichen Projekten anderer Unternehmen verglichen werden. Allerdings fußt die Klassifizierung im Rahmen der EU-Taxonomie auf politischen Deals, durch die beispielsweise Atom- und Gaskraftwerke gleichermaßen als klimafreundlich gelten.
Kosten und Verwaltungsaufwand der zusätzlichen Pflichten sind erheblich. Zumal durch die Senkung der Schwellenwerte in Bezug auf die Verpflichtung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht nur weitaus mehr Unternehmen unmittelbar berichtspflichtig werden, sondern diese auch ihre Zulieferer auffordern werden, entsprechende Informationen zu liefern. Deswegen müssen die Anforderungen verhältnismäßig sein und sich auf ein Minimum beschränken, da KMU nicht in der Lage sein werden, umfangreiche Berichte zu erstellen. Die Befragungsergebnisse lassen vermuten, dass vor allem kleinere Unternehmen nur begrenzt über die notwendigen Ressourcen verfügen, um neues Personal einzustellen, ihr bestehendes Personal weiterzubilden oder auf externe Dienstleister zurückzugreifen. Neugründungen und Neuansiedlungen können dadurch erschwert werden.
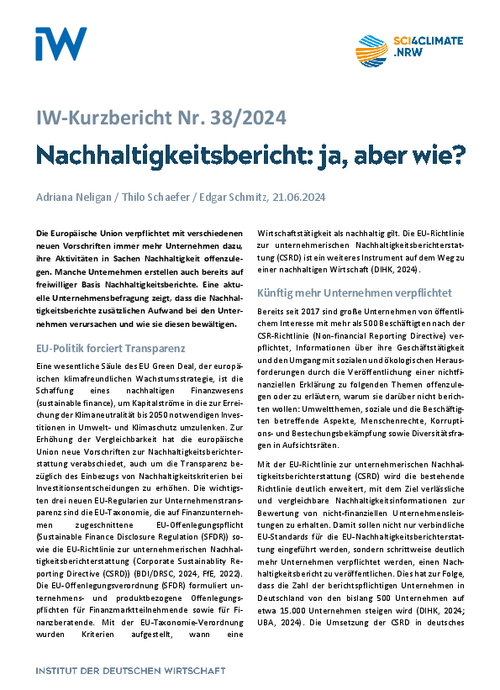
Nachhaltigkeitsbericht: ja, aber wie?


„Europa bietet Chancen für mehr Wettbewerb und weniger Bürokratie. Das sollten wir nutzen“
Was bedeuten die Ergebnisse der Europawahl für die Wirtschaft? Im Handelsblatt-Podcast „Economic Challenges“ diskutieren IW-Direktor Michael Hüther und HRI-Präsident Bert Rürup die Folgen der Wahl und warum jetzt Wettbewerbsfähigkeit statt Green-Deal im Fokus ...
IW
Zölle auf E-Autos aus China: „Es gibt kein Recht auf Billigware”
Peking hat trotz der neuen EU-Zölle auf chinesische E-Autos kein Interesse an einem Handelskrieg, sagt IW-Ökonom Jürgen Matthes. Der europäische Markt sei dafür zu wichtig.
IW