Die Pandemie führt nicht nur zu einem historischen Einbruch der Wirtschaftsleistung weltweit und in Deutschland, sondern hierzulande auch zu einer Rekordneuverschuldung der öffentlichen Haushalte. Bereits Ende März belief sich der Nachtragshaushalt des Bundes auf 156 Milliarden Euro.
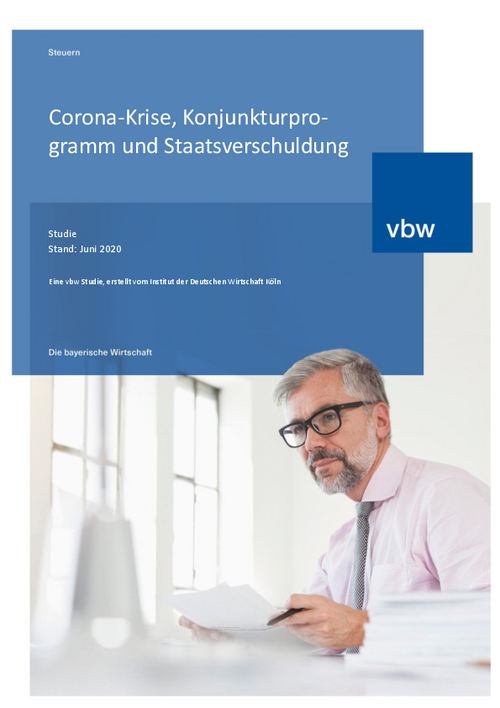
Corona-Krise: Konjunkturprogramm und Staatsverschuldung
Studie im Auftrag des vbw Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

Die Pandemie führt nicht nur zu einem historischen Einbruch der Wirtschaftsleistung weltweit und in Deutschland, sondern hierzulande auch zu einer Rekordneuverschuldung der öffentlichen Haushalte. Bereits Ende März belief sich der Nachtragshaushalt des Bundes auf 156 Milliarden Euro.
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai ergibt sich jedoch ein Finanzierungsbedarf von 166,5 Milliarden Euro. Zusammen mit den Nachtragshaushalten der Länder und den zusätzlich drohenden Defiziten der Kommunen summierten sich zusätzliche Ausgaben und Einnahmeausfälle für den Gesamtstaat damit Ende Mai 2020 auf 287,5 Milliarden Euro.
Um die Wirtschaftsleistung möglichst rasch wieder an das Vorkrisen-Niveau heran zu bringen, hat die Bundesregierung am 03. Juni 2020 in ihrem Koalitionsausschuss ein zusätzliches Konjunkturprogramm aus angebots- und nachfrageorientieren Maßnahmen verabschiedet. Daraus erwächst allein dem Bund nach Einschätzung des Bundesfinanzministers Olaf Scholz ein weiterer Finanzierungsbedarf von rund 120 Milliarden Euro für die Jahre 2020 und 2021. Noch ist nicht abzusehen, ob dieses Volumen auch in gleichem Umfang die Neuverschuldung des Bundes erhöhen wird. Während auf der einen Seite bislang nicht ausgeschöpfte Mittel des ersten Nachtragshaushalts zur Gegenfinanzierung eingesetzt werden können, drohen insbesondere in den Haushalten der gesetzlichen Sozialversicherungen Defizite, die weitere Finanzierungsbedarfe auslösen können. Unter der Annahme, dass das Volumen des Konjunkturpakets in einer Summe im Jahr 2020 durch neue Schul-den finanziert werden muss, steigt der rechnerische Neuverschuldungsbedarf allein beim Bund in diesem Jahr auf insgesamt 286,5 Milliarden Euro.
Die Erfahrungen mit der Finanzkrise 2008/2009 haben gezeigt, dass eine außerordentliche Neuverschuldung kurzfristig hilfreich sein und unter günstigen Voraussetzungen im Laufe eines Jahrzehnts ausgeglichen werden kann. Mit dem im Koalitionsausschuss beschlossenen Konjunkturprogramm würde die Schuldenquote nun abermals über die 80-Prozent-Marke steigen. Bei einer zügigen Wiederbelebung der wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland könnte aber bereits im Jahr 2021 die Schuldenquote wieder auf 80 Prozent sinken, selbst wenn man für das nächste Jahr unabhängig vom aktuellen Konjunkturpaket einen weiteren gesamtstaatlichen Finanzierungsbedarf von über 130 Milliarden Euro unterstellt.
Allerdings basieren diese Rechnungen ebenso wie die aktuelle Steuerschätzung auf der Konjunkturprognose der Bundesregierung vom April. Bei einer ungünstigeren wirtschaftlichen Entwicklung droht der Schuldenstand nochmals höher auszufallen. Einen entsprechend längeren Zeitraum würde damit auch eine Rückführung der Schuldenquote unter die 60 Prozent-Schwelle des Maastricht-Kriteriums beanspruchen.
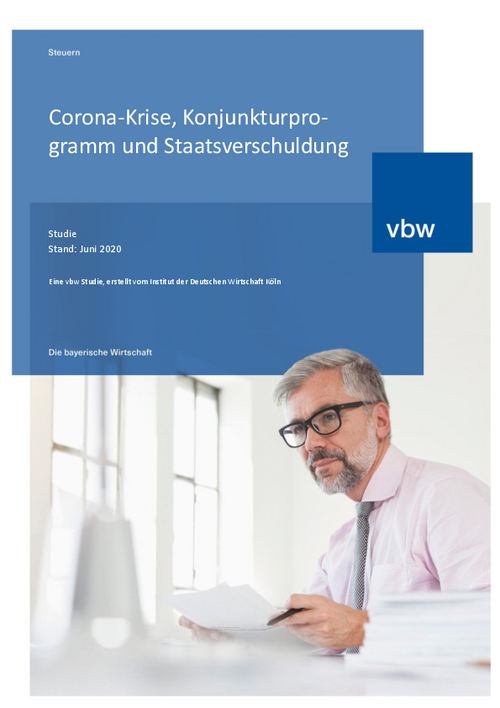
Martin Beznoska / Jochen Pimpertz: Corona-Krise – Konjunkturprogramm und Staatsverschuldung
Studie im Auftrag des vbw Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.


Trotz schwacher Konjunktur: Betriebe möchten teils mehr Personal einstellen
Jeder achte Betrieb plant, die Beschäftigung auszubauen, obwohl ein gleichbleibendes oder sogar sinkendes Produktionsniveau erwartet wird. Das offenbart die IW-Konjunkturumfrage im Frühjahr 2024.
IW
Determinanten der Personalplanung in Deutschland
Der deutsche Arbeitsmarkt ist seit dem Jahr 2005 auf Wachstumskurs. Eine Ausnahme bildet die Corona-Delle zwischen 2020 und 2022. Schon im Jahr 2023 erreichte der deutsche Arbeitsmarkt die neue Rekordmarke von fast 46 Millionen Erwerbstätigen.
IW