Der Solidaritätszuschlag (Soli) sollte als Zuschlag auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer insbesondere die Förderung der ostdeutschen Bundesländer finanzieren. Diesem Zweck ist er nicht nur gerecht geworden, sondern er hat weit mehr geleistet: Im Zeitraum von 1995 bis 2019, dem Jahr des Auslaufens des Solidarpakt II, übersteigen die Einnahmen des Bundes mit 331 Milliarden Euro die Ausgaben zum Abbau der teilungsbedingten Sonderbelastungen in Höhe von 243 Milliarden Euro um 88 Milliarden Euro.
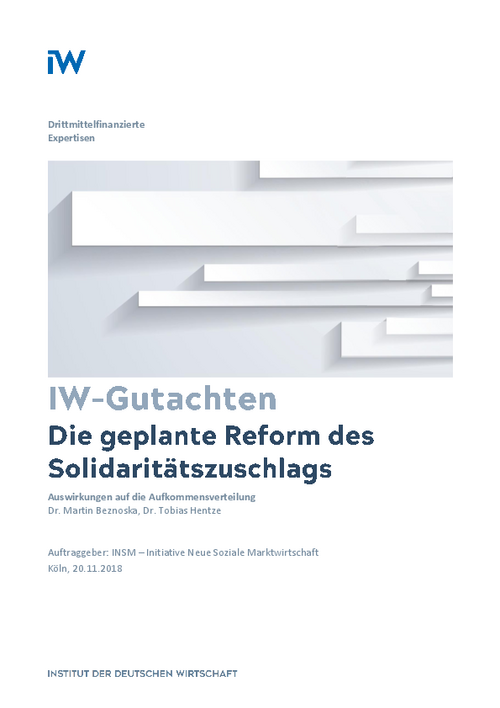
Die geplante Reform des Solidaritätszuschlags
Gutachten im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)

Der Solidaritätszuschlag (Soli) sollte als Zuschlag auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer insbesondere die Förderung der ostdeutschen Bundesländer finanzieren. Diesem Zweck ist er nicht nur gerecht geworden, sondern er hat weit mehr geleistet: Im Zeitraum von 1995 bis 2019, dem Jahr des Auslaufens des Solidarpakt II, übersteigen die Einnahmen des Bundes mit 331 Milliarden Euro die Ausgaben zum Abbau der teilungsbedingten Sonderbelastungen in Höhe von 243 Milliarden Euro um 88 Milliarden Euro.
Da die Einnahmen aus der Ergänzungsabgabe rechtlich nicht zweckgebunden sind, konnte der Bund damit andere Ausgabenprojekte finanzieren. Die Bundesregierung will auch nach Auslaufen des Solidarpakt II im Jahr 2019 – dem „natürlichen Ende“ des Solidaritätszuschlags – an der Ergänzungsabgabe festhalten. Zwar plant der Bund ab dem Jahr 2021 mittels einer neu einzuführenden Freigrenze auf knapp die Hälfte des Aufkommens zu verzichten, immerhin fließen jedoch allein in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt weitere 33 Milliarden Euro aus dem Soli zur freien Verfügung in die Kasse des Bundes.
Dabei ist die von der Bundesregierung geplante Freigrenze aus ökonomischer Sicht fragwürdig. Zum einen geht die Teilentlastung fast vollständig an den Unternehmen vorbei, so dass ihre Steuerlast unverändert bleibt, während die Regierungen in anderen Ländern wie den USA, Frankreich und Großbritannien die Unternehmenssteuern senken. Bei Umsetzung der Reformpläne tragen ab dem Jahr 2021 Unternehmen die Hälfte des Aufkommens, während die anderen 50 Prozent weitgehend von Arbeitnehmern finanziert werden. Bisher liegt der Anteil der Unternehmen bei knapp einem Drittel. Um das Ziel zu erreichen, nur noch die oberen 10 Prozent der Soli-Zahler in der Einkommensteuer zu belasten, müsste die Freigrenze bei einem zu versteuernden Einkommen (zvE) von 62.000 Euro festgesetzt werden. Für Arbeitnehmer, die mit ihrem Einkommen leicht oberhalb der Freigrenze liegen, steigt trotz vorgesehener Gleitzone die Steuerlast bei einem zusätzlich verdienten Euro auf mehr als 50 Prozent an. Der teilabgeschaffte Solidaritätszuschlag wird auch nicht zu einem „Reichen-Soli“. Denn in den Einkommensklassen bis 100.000 Euro zvE im Jahr sind weiterhin knapp 2,9 Millionen Personen betroffen, die hauptsächlich Arbeitnehmer sind und per Definition zur oberen Mittelschicht zählen. Das entspricht rund zwei Dritteln der übrigbleibenden Soli-Zahler in der Einkommensteuer.
Aus verteilungspolitischer Sicht ist unmittelbar ersichtlich, dass bei einem proportionalen Aufschlag auf die progressive Einkommensteuer diejenigen mit den höchsten Einkommen absolut und relativ auch am meisten zahlen. Folgerichtig gilt die gleiche Erkenntnis umgekehrt bei Abschaffung der Ergänzungsabgabe. Die 10 Prozent der Soli-Zahler mit dem höchsten Einkommen tragen die Hälfte des Aufkommens. In der Summe hat diese Gruppe im Zeitraum von 1995 bis 2019 rund 138 Milliarden Euro Solidaritätszuschlag bezahlt und soll nach den Plänen der Bundesregierung auch noch kaum entlastet werden.
Im Ergebnis ist zu befürchten, dass der Reformvorschlag der Bundesregierung das Wachstumspotenzial der deutschen Volkswirtschaft und damit auch die künftigen Steuereinnahmen bremst. Dabei wäre angesichts der Historie des Solidaritätszuschlags und der kräftig gestiegenen Steuereinnahmen die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags Ende 2019 ein logischer und machbarer Schritt.
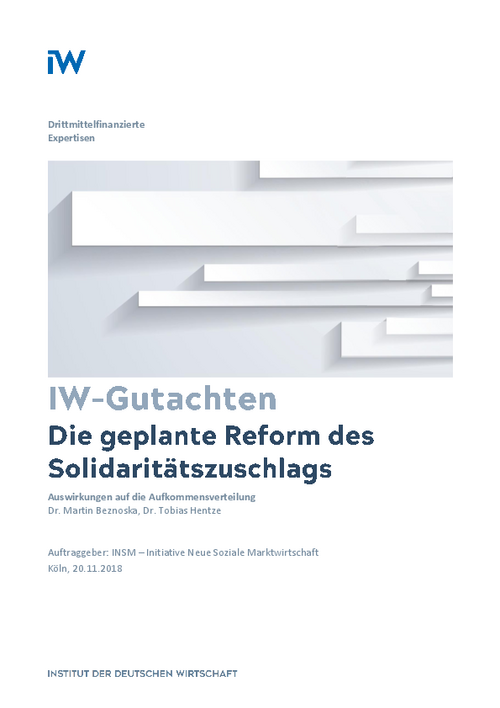
Martin Beznoska / Tobias Hentze: Die geplante Reform des Solidaritätszuschlags – Auswirkungen auf die Aufkommensverteilung
Gutachten im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)


Bundeshaushalt: Zinslasten und realer Einnahmenrückgang setzen Regierung unter Druck
Das Haushaltsvolumen des Jahres 2024 ist gegenüber dem Jahr 2019, dem letzten Vorkrisenjahr, um ein Drittel oder 120 Milliarden Euro gestiegen. Zinsen und Soziales sind dafür maßgeblich verantwortlich. Die Steuereinnahmen können im Vergleich dazu nicht ...
IW
Inflationsausgleichsprämie: Ohne Tarifvertrag weniger Verbreitung
Die bis Ende des laufenden Jahres befristete steuer- und sozialabgabenfreie Einmalzahlung sollte und soll als Teil der Entlastungspakete die Folgen der Energiepreiskrise abfedern. Damit verzichtet der Staat auf Einnahmen von schätzungsweise 25 Milliarden Euro ...
IW